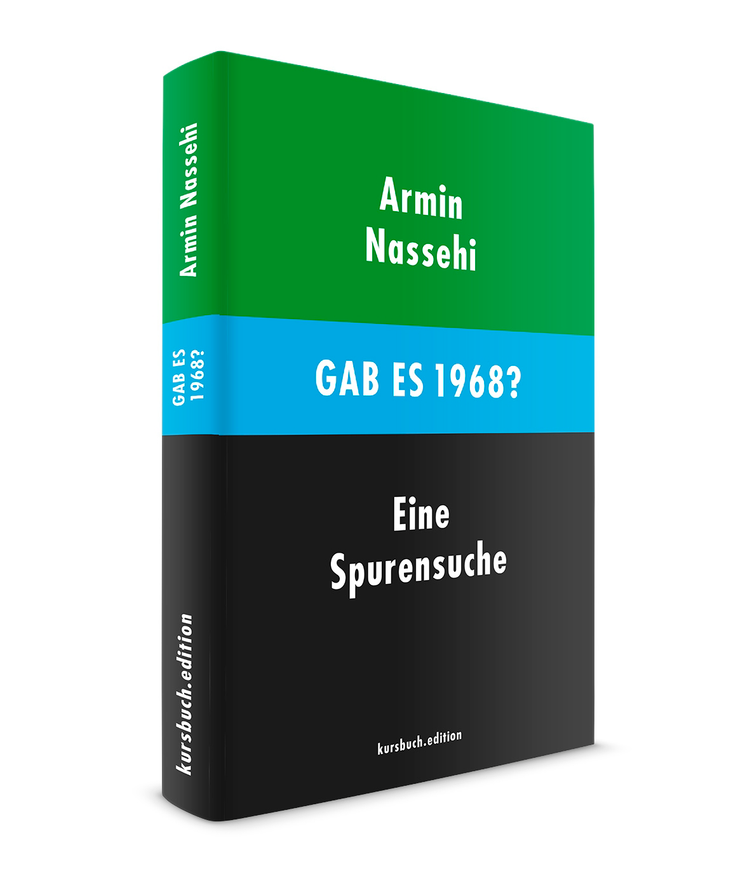STANDARD: 1968 haben nicht nur viele junge Menschen gegen Werte und Lebensweisen der Eltern revoltiert. Auch viele Eltern haben sich quasi neu erfunden. Welche Auswirkungen hatte 1968 auf das Elternsein, abgesehen von den eher ungeliebten Putzdiensten in den selbstverwalteten Kinderläden?
Nassehi: Wenn wir von 1968 reden, müssen wir unterscheiden zwischen der harten, kleinen Gruppe, die sehr sichtbar wurde, und der Generationslage, die in der Tat viel verändert hat in der Gesellschaft, und zwar vor allem bezüglich fester Rollenzuweisungen und Hierarchien. Die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern, aber auch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern, Professoren und Studenten sowie zwischen Eltern und Kindern haben sich verändert. Das ging nicht von jetzt auf gleich, sondern die Gesellschaft erlebte, wie ich das nenne, Inklusionsschübe.
STANDARD: In welcher Form?
Nassehi: Es kamen mehr Leute in die Institutionen hinein, darum spielte Erziehung auf einmal eine viel größere Rolle. Davor sind Kinder in Familien einfach so mitgelaufen. Für die explizit linken 68er war das auch deshalb ein Thema, weil sie dachten, man könne über Kindererziehung die Gesellschaft verändern. Da waren die Familie, Schulen, Universitäten und andere Ausbildungsstätten gefragt. 1968 war also auch eine Zeit der Pädagogisierung der Gesellschaft.
STANDARD: Der Philosoph Theodor W. Adorno schrieb in seinem schon 1965 erschienenen Buch "Erziehung nach Auschwitz": "Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an die Erziehung." Eine Lesart von 1968 ist ja, dass es auch eine Revolte gegen die "Naziväter" bzw. "Nazimütter" war – war dem so?
Nassehi: Natürlich ist die Erfahrung mit dem Nationalsozialismus gerade in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sehr prägend gewesen. Aber in der Öffentlichkeit spielte das Thema damals eine viel geringere Rolle, als das für uns heute selbstverständlich ist. Das kam erst 1979, als in Deutschland und Österreich die US-Serie Holocaust ausgestrahlt wurde. Der Nationalsozialismus diente 1968 eher als argumentativer Anker, um zu legitimieren, was man "Widerstand" nannte. Der explizit linke harte Kern der 68er behauptete ja, es habe eine starke Kontinuität des Nationalsozialismus bis in den Rechtsstaat der 60er-Jahre gegeben, die Gegenwart sei also im Prinzip faschistisch und man müsse dagegen, auch gewaltsam, vorgehen. Adorno meinte viel mehr. Er war auch alles andere als ein Stichwortgeber für die 68er.
STANDARD: Sondern?
Nassehi: Er hat Auschwitz als Zeitenwende angesehen und meinte, das Einzige, was wirklich helfen kann, wenn überhaupt, sei Erziehung. Das ist eher ein generationstypisches Muster, das gar nicht so viel mit den 68er-Kämpfen zu tun hat. Das sehen wir ja noch heute, wenn es irgendwelche Krisen gibt, heißt es: "Wir brauchen entsprechende Bildungsmaßnahmen."
STANDARD: "1968" wurde zu einer nachgerade janusköpfigen Chiffre. Einerseits steht sie für neue Freiheiten und Emanzipation, andererseits werden "die 68er" für Übel aller Art verantwortlich gemacht: Seien es schlechte Pisa-Ergebnisse, undisziplinierte, schlecht erzogene Kinder oder die Zerstörung der Familien. Horst Petri beklagte etwa die Vaterlosigkeit, Claus Leggewie machte in den 90ern die 68er für den Rechtsradikalismus verantwortlich. Warum taugt "1968" als positive wie negative Folie?
Nassehi: 1968 ist ein Erinnerungsgenerator, den man für unterschiedlichste Zwecke instrumentalisieren kann. Darum arbeiten sich ja nicht nur Linke wie Claus Leggewie daran ab, sondern auch CSU-Politiker wie Alexander Dobrindt, der eine konservative Revolution fordert, oder die neuen Rechten, die in 1968 das Symbol sehen, dass man die Welt gewissermaßen verloren hat. Eine größere Anerkennung für '68 kann es gar nicht geben.
STANDARD: Welche Welt ist denn vor 50 Jahren verlorengegangen?
Nassehi: 1968 ist auch ein Symbol dafür, dass die Gesellschaft inklusiver, durchlässiger geworden ist. Das kann man gerade, was Kindererziehung, Schule oder Berufsausbildung und Studium angeht, sehen. Eine Welt, in der die Schichten stabil waren, in der es ein Schulsystem gab, in dem die Leute am Beginn schon wussten, wie die Bildungskarriere am Ende aussehen wird, war eine relativ einfache Welt. Wenn die Welt komplizierter wird, muss man plötzlich darüber reden, nachdenken und neue Konzepte entwickeln. Unter dieser komplizierten Welt leiden viele. Wer mit wem warum und wie und was erlaubt ist und was nicht, wie man Kinder erzieht, was die werden sollen, was Elternrollen zwischen den Eltern und gegenüber den Kindern bedeuten – das sind ja alles Fragen, die die Welt nicht einfacher machen. In diesem Sinne wurden in der 68er-Generation tatsächlich die heile Familie und die schöne hierarchische Gesellschaft infrage gestellt, wie es von Konservativen wieder beklagt wird.
STANDARD: Sie unterscheiden in Ihrem Buch "Gab es 1968?" eine explizite und eine implizite Linke, die 1968 geprägt hätten. Inwiefern?
Nassehi: Die explizite Linke ist ja sehr sichtbar gewesen, eine Symbolfigur ist Rudi Dutschke. Diese Leute wollten die Gesellschaft revolutionär verändern. Das war 1969 vorbei, weil es letztlich nicht umsetzbar war. Implizit links dagegen nenne ich, was ich mit dem soziologischen Begriff der Inklusionsschübe meine, also zum Beispiel Bildungsinklusion. In den 60er-Jahren lag die Abiturientenquote in Deutschland bei unter zehn Prozent, heute bei über 50 Prozent. In den 70er-Jahren gab es vielfältige Möglichkeiten sozialen Aufstiegs. Fachhochschulen wurden gegründet, es gab das berühmte BAföG, quasi ein finanzieller Rechtsanspruch auf eine universitäre Ausbildung, wenn man entsprechende Leistungen bringt, sogar ein Meister-BAföG, also für Ausbildungen im Handwerk. Alles Dinge, durch die die Gesellschaft egalitärer und aufwärtsmobiler wurde, zumindest ansatzweise, auch wenn es Rückschläge gab und man sah, dass die Herkunft der Menschen doch stärker durchschlägt, als die politischen Programme das wollten.
STANDARD: Und die Pädagogik?
Nassehi: Die Pädagogik war auch nicht in der Lage, diese Unterschiede völlig wettzumachen. Aber das war schon ein implizit linkes Programm, weil man mehr Gruppen der Gesellschaft an den Entwicklungen ihrer Institutionen teilhaben ließ. Der Wind of Change wehte von links, dem konnten sich auch konservative Kräfte nicht entziehen. Es gibt in Deutschland kein Bundesland, in dem die Durchlässigkeit so groß ist wie in Bayern, um über den zweiten und dritten Bildungsweg an Bildungsabschlüsse zu kommen – und in Bayern gibt es seit Jahrzehnten nicht unbedingt eine linke Politik. Das war geradezu etwas Unvermeidliches. Heute aber kommt der Wind eher von rechts.
STANDARD: Der sich in rechten oder rechtspopulistischen Regierungen manifestiert? Sehen wir heute also eher Exklusionsschübe, bei denen es darum geht, bestimmte Gruppen draußen zu halten?
Nassehi: Ja, aber auch hier ist die Unterscheidung zwischen implizit und explizit wichtig. Wenn wir heute an explizit rechte Aktivisten denken, dann benutzen die ganz ähnliche Protestformen wie die 68er, um den Staat herauszufordern, die Polizei zu Überreaktionen zu bringen und der bürgerlichen Mitte Angst zu machen. Aber entscheidender ist das implizit Rechte. Wir diskutieren heute tatsächlich wieder darüber, wer dazugehört und wer nicht, ob jemand, der keinen deutschen Nachnamen hat, in der Nationalmannschaft spielen sollte oder ob die europäische Integration nicht doch zu viele offene Grenzen hat. Da hat man mit einer implizit Rechten zu tun.
STANDARD: Und was tut die Linke?
Nassehi: Ich würde vielen der kulturlinken Bewegung vorwerfen, dass sie sich eher am implizit Rechten abarbeiten, also an der Frage: Wer bin ich denn eigentlich? In den 70er-Jahren hat man böse darüber gespottet, wenn jemand ernsthaft wissen wollte, was man eigentlich ist. Das haben wir alles dekonstruiert über Jahrzehnte, und jetzt wollen die Leute wissen, wer sie wirklich sind? Armin Mohler, der rechte Theoretiker und Antiliberalist, hat geschrieben: "Die Liberalen beurteilen die Menschen danach, was sie sagen, nicht danach, was sie sind." Das hört sich unspektakulär an, aber da ist all das drin. Man kann sich noch so sehr anstrengen, man bleibt, was man ist. Das ist etwas, das wir heute durchaus erleben, in Österreich sogar in der Regierung: die Idee, die implizit immer mitschwingt, das Eigene und das Fremde, das Dazugehören und Nichtdazugehören. (Lisa Nimmervoll, 19.5.2018)